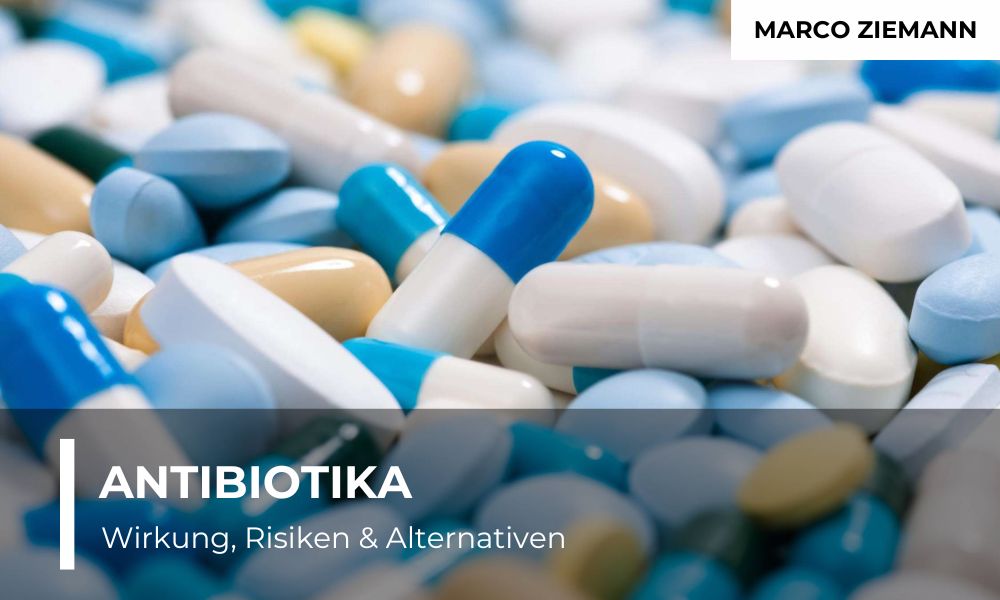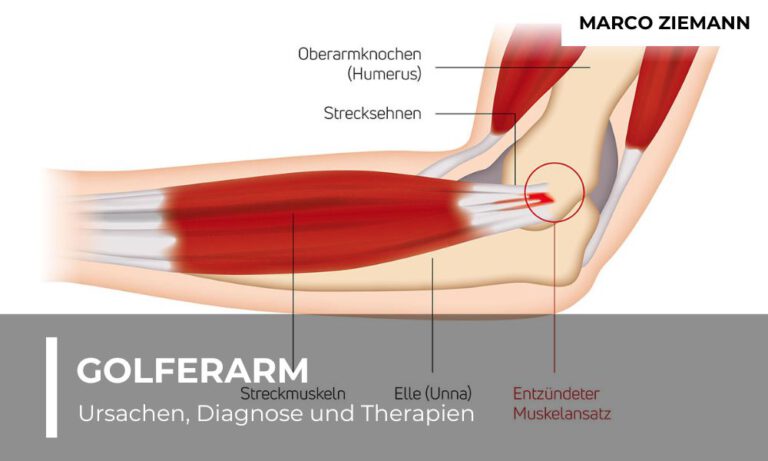Superkeime: Warum wir den Wettlauf gegen die unsichtbaren Gegner nicht verlieren dürfen
Es gibt Themen, die zunächst abstrakt wirken, fast wie eine ferne Bedrohung, die jedoch unser Leben unmittelbar betreffen. Eines davon sind Antibiotikaresistenzen. Allein in Europa sterben jedes Jahr rund 35.000 Menschen an Infektionen mit multiresistenten Bakterien. Weltweit liegt die Zahl bei über einer Million. Was früher eine sichere Waffe war – Antibiotika gegen Lungenentzündung, Blutvergiftung oder Tuberkulose – droht stumpf zu werden. Die Vorstellung, dass einfache Operationen oder Infektionen wieder lebensgefährlich werden könnten, ist beängstigend. Und doch ist genau das die Realität, in die wir langsam hineinrutschen.
Die Gefahr der Superkeime
Warum Antibiotika ihre Wirkung verlieren
Ich erinnere mich an meine eigene Verwunderung, als ich erfuhr, wie rasant Bakterien evolvieren können. Während unsere Medikamente gleichbleiben, verändern sich diese Mikroorganismen in einem atemberaubenden Tempo. Sie tauschen genetische Informationen aus, entwickeln Pumpmechanismen, um Antibiotika wieder aus der Zelle zu schleusen, oder verändern ihre Angriffspunkte so, dass kein Wirkstoff mehr greift.
Ein stiller Gegner im Krankenhaus
Besonders gefährlich ist, dass die größten Schlachtfelder dort liegen, wo wir Menschen ohnehin am verletzlichsten sind: in Krankenhäusern. Ohne Antibiotika wären Transplantationen, Krebstherapien oder die Intensivmedizin undenkbar. Und doch sind es gerade diese Orte, an denen Superkeime besonders oft auftreten – begünstigt durch den massiven Einsatz von Medikamenten.
Die Rolle des Menschen
Natürliches Phänomen – verstärkt durch falschen Einsatz
Resistenzen sind kein reines „Menschenwerk“. Bereits vor Hunderten von Jahren trugen Tiere wie Igel multiresistente Keime in sich. Doch unser Umgang mit Antibiotika – von der übermäßigen Verschreibung bis hin zum Einsatz in der Massentierhaltung – hat das Problem massiv verstärkt.
Ein Paradox für die Pharmaindustrie
Die Entwicklung neuer Antibiotika dauert Jahre, kostet Milliarden und ist für die Industrie unattraktiv. Selbst wenn ein neues Mittel auf den Markt kommt, bleibt es oft ein „Reserve-Antibiotikum“, das möglichst selten eingesetzt wird. So wird ein dringend benötigtes Medikament zum Ladenhüter – ein Paradoxon, das unsere Lage verschärft.
Neue Lösungsansätze im Kampf gegen Resistenzen
Bakteriophagen – Viren als Helfer
Umso faszinierender sind alternative Ansätze. Als ich zum ersten Mal von Bakteriophagen hörte, war ich verblüfft: Das sind Viren, die ausschließlich Bakterien befallen und zerstören, ohne uns Menschen zu schaden. Schon im Zweiten Weltkrieg wurden sie eingesetzt, in Osteuropa nie ganz vergessen, und heute erleben sie ein Comeback.
Antivirulenz-Strategien
Auch sogenannte Antivirulenz-Strategien eröffnen neue Wege: Anstatt die Bakterien zu töten, werden sie sozusagen „entwaffnet”. Sie verlieren die Fähigkeit, Biofilme zu bilden oder unser Immunsystem zu umgehen. Das ist zwar keine endgültige Lösung, aber ein Ansatz, um das Spielfeld wieder auszugleichen und unserem Immunsystem die Oberhand zurückzugeben.
Was wir jetzt tun müssen
Ich bin überzeugt: Wir brauchen einen gesellschaftlichen Schulterschluss. Weniger Antibiotika bei banalen Infekten, strengere Hygienemaßnahmen und mehr öffentliche Investitionen in Forschung gehören zusammen. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, könnte der Antibiotikaverbrauch bis 2030 weltweit um mehr als 50 Prozent steigen. Dann wird das, was heute noch eine Prognose ist, zur brutalen Realität: Infektionen werden zur größten Todesursache, noch vor Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Am Ende bleibt für mich eine Erkenntnis: Wir dürfen nicht naiv sein. Der Wettlauf mit den Superkeimen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir müssen lernen, so anpassungsfähig zu werden wie die Bakterien selbst: kreativ, beharrlich und stets einen Schritt voraus. Denn eines ist klar: Abwarten und Hoffen ist keine Option.